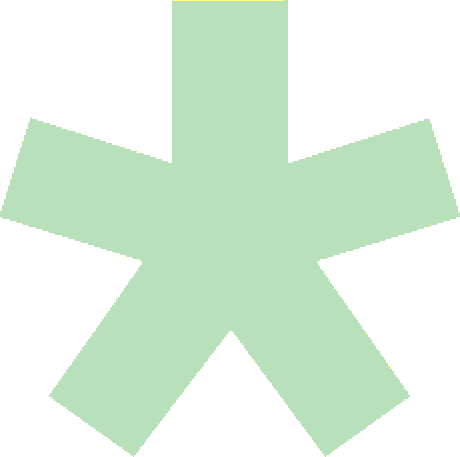Ein Plädoyer für mehr Offenheit im Umgang mit Trauer, Wut und Angst – Gefühle sind Teil unseres Menschseins. Freude, Glück und Begeisterung gelten als wünschenswert und akzeptiert, während Trauer, Wut und Angst oft verdrängt oder tabuisiert werden.
Diese Tabuisierung ist gefährlich: Sie führt dazu, dass viele Menschen mit Depressionen, Angststörungen oder familiärer Gewalt schweigen und sich zurückziehen, anstatt Hilfe zu suchen.
Warum Trauer, Wut und Angst tabuisiert werden
Unsere Gesellschaft neigt dazu, Stärke mit dem Verdrängen negativer Gefühle gleichzusetzen. „Reiß dich zusammen“, „Das wird schon wieder“ oder „Anderen geht es schlechter“ – diese Sätze spiegeln eine Haltung wider, die Betroffene entmutigt und isoliert. Dabei sind Trauer, Wut und Angst ebenso menschlich wie Freude. Sie dienen als Signale: Sie zeigen an, wenn etwas nicht stimmt, wenn wir verletzt sind oder uns schützen müssen.

Wenn Tabuisierung krank macht
Aus Scham oder Angst vor Stigmatisierung suchen viele Betroffene keine Hilfe. Wer unter Depressionen leidet, kämpft nicht nur mit innerem Leid, sondern auch mit der Angst, von anderen abgestempelt zu werden. Wer Gewalt in der Familie erfährt, schweigt oft aus Furcht vor Schuldzuweisungen. Wer unter Angstneurosen leidet, wird nicht selten belächelt. Diese Mechanismen verschlimmern das Leid und verhindern frühe Interventionen.
Politische Entwicklungen – Gefahr der Stigmatisierung
Besonders problematisch sind politische Vorschläge, die eine Art Register für psychisch erkrankte Menschen schaffen wollen. Solche Ideen, wie sie vor allem rechte Politiker äußern, verschärfen nicht nur das Stigma, sie bedrohen auch die Grundrechte Betroffener. Psychische Erkrankungen sind keine Delikte, sondern gesundheitliche Herausforderungen, die Behandlung und Unterstützung brauchen – nicht Kontrolle und Ausgrenzung.
Trauer, Wut, Angst: Wie Hilfe gelingen kann
Hilfe beginnt mit Zuhören und Akzeptanz. Betroffene brauchen keine Urteile, sondern sichere Räume. Drei zentrale Punkte:
- Sprache ändern: Worte wie „verrückt“ oder „schwach“ tragen zur Abwertung bei. Ein respektvoller Sprachgebrauch ist essenziell.
- Frühzeitige Unterstützung: Leichte Symptome ernst nehmen und nicht warten, bis eine Krise eskaliert.
- Entlastung für Familien: Angehörige sind oft Mitbetroffene. Sie brauchen Informationen, Austausch und Unterstützung.

Hilfestellung geben – ohne Stigma
Die wichtigste Hilfestellung besteht darin, Betroffene nicht in eine Rolle der Schwäche zu drängen. Wer Unterstützung anbietet, sollte dies behutsam tun: Fragen stellen statt Ratschläge aufzwingen, Optionen aufzeigen statt Entscheidungen abnehmen, und Hilfe normalisieren – etwa, indem man psychotherapeutische Unterstützung so selbstverständlich erwähnt wie einen Arztbesuch.
An das Gute im Menschen glauben
Eine solidarische Gesellschaft lebt davon, dass sie niemanden allein lässt. Psychische Krisen sind keine Ausnahme, sondern Teil der menschlichen Realität. Wer Betroffenen zuhört, sie ernst nimmt und respektiert, trägt aktiv dazu bei, dass Tabus verschwinden und Menschen rechtzeitig Hilfe erhalten. Es geht darum, ein Klima zu schaffen, in dem Hilfesuchen kein Zeichen von Schwäche ist, sondern von Mut.
Die gezeigten KI-generierten Bilder zu Trauer, Wut und Angst verdeutlichen, wie nah diese Gefühle an der Oberfläche liegen – und wie wichtig es ist, ihnen Raum zu geben. Nur so können wir Betroffene stärken statt sie auszugegrenzen.
SH, Karlsruhe, September 2025
(Beitragsbild: “Trauer“ – KI Bild Blitz-ART-ig 09.2025)